Die Muschel
Die Geheimhaltung um den künftigen Inhalt des Edelstahl-Topfs neben dem Zeltling des Königs der Löwen liesz fremdere und gröszere Abenteuer vermuten, galaktische, kühne, flüssige.
Doch dann eröffnete Stage-Entertainment im November 2014 ihr „architektonisches Juwel“ mit dem Wunder von Bern, Musical-Remake eines Films, mehrfach Stage-erprobt, dies hier kommt erdig, krumig und biedersinnig daher: Ruhrpott und Kumpel, Fünfziger Jahre, Wohnküche, Stollen im Erdinneren und an den Männerfüszen, Heimat durchexerziert.
Die Überraschung ist die, dasz es keine gibt.
Stellen wir uns eine Muschel vor, eine glatte, „7.500 Edelstahlschindeln“ bedecken den Deckel, ein hartes männliches Auszen birgt ein weibliches, weiches, rotes Theater-Innen. Nach dem Barkassen-Shuttle von den Landungsbrücken hinüber nach Steinwerder orientiere ich mich im weitläufigen Foyer in Heteronormativität und Adjektivität: das „einzigartige und atmosphärische (sic) Stage-Theater“, die „besondere Magie“, das „spektakuläre Bühnenbild“, die „emotionale Geschichte“, die „atemberaubende Seiltechnik“. Abend und Unterhaltung seien, so ebenfalls das Programmheft, „perfekt“.
Grammatisch und auch passend ist das die vollendete Zeit. Ein Spiel: wer von den Musical-BesucherInnen ist aus Hamburg, wer ist touristisch hier und wer hat welche der im Januar und Februar reichlich verteilten Freikarten ergattern können? Haben die Aufgebrezelten 52 bis 122 Euro bezahlt, und sind die mit Rucksack und ohne Schminke Schnorrer? Die, bei denen die Geschlechtsrollen weniger klar erkennbar sind?
In meine Vorfreude mischt sich Vorangst, wie soll die Begegnung mit dem Makellosen verlaufen, werde ich unperfekter Mensch es erkennen und goutieren können?
An Magie glaube ich nicht, mein Vertrauen in feste Beziehungen zwischen Ort und Handlung ist schwach entwickelt und bildet sich weiter zurück, dessen ungeachtet kann ich den Ort der beiden Musical-Theater (von Stage phantasievoll als AIDA-Musical-Boulevard bezeichnet) nie sehen ohne seine vorherigen Industrie-Nutzungen. Steinwerder war über hundert Jahre lang Werften-Standort, hier standen die Kabelkrananlagen und Helgen der Stülcken-Werft. Nach der Übernahme durch Blohm und Voss wurde der Laden 1967 geschlossen, das letzte Schiff war ein Kriegsschiff für die deutsche Marine. Strukturwandel: Zwanzig Jahre später Abbruch der Anlagen, Bodenaustausch und Bodenwäsche und sturmflutsichere Aufhöhung. Der De-Industrialisierung folgt die Musicalisierung und ich bin gespannt auf die weitere Fruchtfolge und die entsprechende Dekontamination.
Teil der Stahlschiffbaugeschichte ist die Einrichtung eines Aussenlagers des Konzentrationslagers Neuengamme im November 1944. SS und die Leitung der Stülckenwerft richteten es ein. Am 22. November 1944 wurden 250 Männer mit der Barkasse zu ihrem Einsatzort und zu Werft- und Aufräumungsarbeiten gebracht. Mindestens 79 überlebten es nicht. Am 21. April wurde das Lager geräumt und die Häftlinge wurden nach Sandbostel und in schier unvorstellbare Verhältnisse verschoben, damit die ehemalige Führerstadt Hamburg rein von dreckigen Häftlingen wäre. Die Männer stammten aus Ungarn und waren Juden. (Die Stage-Gäste müssen die schwarzen Erinnerungs-Tafel beim Alten Elbtunnel nicht sehen.)
Plunder
Des Reimes wegen, des welterklärenden, gedächtnisfreundlichen, des Musical-zusammenkittenden, heiszt es hier nun Plunder statt Wunder. Wenn das Stück ein Gebäck wäre, könnte es aus Plunderteig sein, pludern von Aufgehen, ein Ziehteig aus Hefeteig und viel Fett, mehrere Falt- und Ausrollvorgänge gestalten es, ein keineswegs unfreundlich gemeinter Vergleich. Das Wunder-Gebäck ist Hauptspeise des Abends, ist Hoffnung und Erlösung zugleich. In den meisten Religionen ist der Wunder-Teig komplett unverzichtbar.
Vier Songs im Wunder von Bern tragen das W.-Wort im Titel. „Wunder geschehen“ (drei mal), „An Wunder glaubt doch jeder“.
Das Wunder ist das Kapital der Ausgeplünderten oder in falschen Verhältnissen Geborenen. Wunder ist die Ultima Ratio des Unvernünftigen, die Letztbegründung vor dem Abspann. Hungrig musz man aber schon sein fürs Wunder. Neben dem fett glänzenden Wunder-Gebäck steht die Bouillon, wie Entenflott schwimmt oben Petersilie und auf der Terrine steht Schicksal, das gibt es immer noch, wenn alles aus ist. Das moderne Musical hat Schicksal eingearbeitet in den Plunderteig, Hagelzucker darüber gestreut und meint es gut mit allen Guten und denen, die reinen Herzens sind.
Ein anderes groszes Wunder, auf das angespielt wird, war in Wirklichkeit keines, aber es musz eines sein für uns, das Wirtschaftswunder.
Das Wundern der ZuschauerInnen ist die kleine Münze und die ZuschauerInnen wundern sich über die Perfektion der Technik, oder nein, sie erwarten sie, sie haben eben die bezahlt. So bleibt das Wunder grosz. Sie bekommen Wunder und Illusionen; Pessesprecher Holger Kersting wird im Hamburger Abendblatt vom 30./31. Januar zitiert: „Illusionen leben von Perfektion“. (Artikel von Yvonne Weiß, Der Musical-Marathon) Die Sehgewohnheiten der Zuschauer hätten sich extrem geändert und man konkurriere nicht nur mit dem Kino sondern auch mit TV-Sendern wie Amazon oder Netflix. Die Beglückungsindustrie macht Druck, das Publikum rennt mit oder voraus, wer weisz das so genau.
Lok und Schlot
Die Handlung des Musicals – Vater Lubanski kommt aus Kriegsgefangenschaft zurück, bleibt zunächst fremd und feindlich, bis sich vor dem Hintergrund der Fuszballweltmeisterschaft 1954 er und der jüngste Sohn in Herz und Arme schlieszen – spielt vor malerisch rauchenden Schloten, und eine fauchende höchst echt wirkende Lokomotive bringt die simple Handlung aufs Gleis, indem sie den schwachen, entmaskulinisierten Mann zur wartenden Familie bringt.
Hintergrund eins ist Deutschland als Kind, alles ist klein in der Erinnerung und jede Menge Zukunft gibt es, in der alles schöner, gröszer, bunter wird und grosze Rollen warten auf das Kind und das Land. Dreck ist Glück und Rusz = Sott (plattdeutsch) sagt das ja auch.
Hintergrund zwei ist das eingebildete Herz Deutschlands, rau und herzlich, Kohle im Berg und Hände, die zupacken. Ehrliche Malocher und Taubenzüchter. Wo gibt es das schon? Die rauchenden Schornsteine sind die Versprechen, wo sieht man das noch so?
Und Hintergrund drei ein Traum von Vergangenheit, eine Projektion, wie die im Hintergrund der Deutschland-und-Familien-Story. Gewisz geht es nicht ohne Projektionen ab in Geschichts-Geschichten. Aber wieviel Erfindung verträgt eine in den 50er Jahren angesiedelte Handlung?
O-Ton Stage: „Über die Kraft der Familie und den Moment, der unser Land für immer veränderte.“ Für mich ein perfekter Verblendungs- und Verblödungs-zusammenhang. „Unser Land“ ist kaum mein Land, jedenfalls nicht im Sinne von Eigentum oder auch nur von emotionaler Identifikation. Mit „Moment, der … für immer veränderte“ ist offenbar der Sieg in der Fuszballweltmeisterschaft über Ungarn gemeint. Was ich nicht wuszte und auch im Theater nicht erfuhr, ist, dasz die ungarischen Fuszballer damals die besten der Welt waren. Die Männer im roten (ungarischen) Trikot legen in der ersten Musical-Halbzeit ein wirklich fulminantes Ball-Ballet hin. Später denke ich, dasz die Ungarn schön tänzeln sollten, um die Überlegenheit der deutschen kampfesmutigen Balltreter zu illustrieren, die, groszes Thema, bei schlechter Witterung und schwerem Boden zu Hochform auflaufen. Dies auch, weil sich Kapitän Fritz Walter in russischer Kriegsgefangenschaft Malaria zugezogen hatte. Ungarn und die ungarischen Spieler haben im Musical keine Kriegs-Relation.
Heimkehrer Lubanski, auch er spielte früher Fuszball und ist so verbunden mit den deutschen Nationalspielern, war 12 Jahre in russischer Gefangenschaft und das hat die Zeit davor offenbar ausradiert. Zwei Hinweise dafür, dasz das Musical nicht in den 60er Jahren geschrieben wurde: zweimal wird erwähnt – der Part von Sohn Bruno, der nach Ost-Berlin gehen wird, dasz die Deutschen die Russen überfallen haben.
Dies war mein persönliches Highlight, die Erinnerung an die rhetorische deutsche Möglichkeit, alle Probleme geographisch zu lösen durch das jeweilige „Nach-Drüben-Gehen“.
PTBS
Der Held ist impotent und leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung – unter Tage verwandelt sich sein Bohrhammer in eine Schuszwaffe, der Krieg dauert an für ihn. Nun prädestinieren Leiden Männer nicht zu Helden, der Figur Richard Lubanski bringen sie jedoch im Musical wie im Zuschauerinnenkreis viel Empathie und Sympathie ein. (Übrigens schlägt der Mann gemeinerweise seine Söhne, anstatt zurück zu schlagen, beginnen sie zu singen.) Warum stöszt diese Story auf soviel Begeisterung und wird für „tiefsinnig und deutsch“ gehalten? (So die Chefredakteurin des Hamburger Abendblattes.) Warum ist jetzt ein Zeitpunkt, einen kranken Mann, einen Mann, der seine Rolle nicht erfüllen kann und dieses nicht zu reflektieren braucht, auszustellen und den Weg der Re-Maskulinisierung zu feiern? Sind das die Repräsentationen angeknackster Männlichkeit im 21. Jahrhundert? In jedem Fall brauchen wir das Patriarchat nicht zu verabschieden, solange Frauen dulden und heilen. Grösztes Tabu: dasz die Frauen nicht mehr mitspielen.
Dasz Männer sehr gut Arschlöcher sein können und sich alles um sie dreht, verständnis-, liebe- und humorvoll, zeigen übrigens auch die Lingnau-Produktionen Villa Sonnenschein, Heisze Ecke und die Königs vom Kiez.
Herrschaftsstabilisierend und kulturindustriell ist das allemal. Eine Kritik, die bei Musical-FreundInnen (eine halbe Million schaute bislang das Wunder von Bern) auf ebenso viel Unverständnis stoszen dürfte, wie bei Nicht-Musical-Gängern, die Affirmation für die Geschäftsgrundlage der Veranstaltungen halten.
Der Untertitel stellt es klar: „Er suchte einen Helden und fand seinen Vater.“
Der Held ist Opfer deutscher Geschichte und somit selbst das männliche Deutschland. Offenbar sind – eine sehr schöne Vorstellung – alle Täter gefallen oder haben sich entleibt. Der Vater und Deutschland sollen und werden wieder aufgebaut. Es fällt mir spontan kein öderes Thema ein.
Und die Bühnen-Frauen?
Tragen schicke Kleider. Interessieren sich nicht für Fuszball. Dulden und Dekorieren, waren tüchtig. Es gibt keine Szene, in der zwei Frauen miteinander reden, es gibt nur männliche Themen, alle Frauen sind auf Männer bezogen.
Es gibt also eigentlich gar keine ernstzunehmenden weiblichen Rollen. Da es ein Stück „für die ganze Familie“ (Stage) ist, manch ein/e Kritiker/in attestierte auch das Lehrhafte daran, lernen Mädchen und Frauen ihre Nichtigkeit, ihre läppischen Wünsche und ihre völlige Bedeutungslosigkeit. Kaum einer fällt das auf, was ich geneigt bin, für einen Effekt der perfekten oder besser totalen Unterhaltung zu halten. Trojanische Pferde aus dem Tingeltangel? Nein, hier musz in gröszeren Dimensionen gedacht werden. Tut Stage ja auch.
100 Lautsprecher
Die Musik ist sehr laut. Für meine (Minderheiten-)Empfindung zu laut. Über 100 Lautsprecher sind im Saal verteilt, Surround System. Gesamtleistung, das preist wieder das Programmheft an, 100.000 Watt; welch Whirlpool-Feeling, Wonnen zwischen Wehrlosigkeit und Wahn.
Die 17 Musiker die (wirklich?) live spielen, sitzen in einem Kabuff unter der Bühne und sind für die Zuschauer nicht sichtbar.
Und WAS tönt?
Ich bin in solchen Momenten dankbar für meine mangelnde musikalische Bildung. Und dafür, dasz ich kein auditiver Mensch bin. Daher ein Wort zu den Worten. Die Songtexte von Frank Ramond sind von ozeanischer Schlichtheit.
Als besonders peinvoll erlebte ich den Song der Tochter Ingrid Lubanski, der Papa gerade den Umgang mit einem GI untersagt hat: „Ich will doch nur leben, ist das denn zuviel verlangt? Was Schönes erleben, Stunden, die man lieben kann, sowas musz es für mich doch geben, so ein biszchen Leben.“ Auf englisch bestimmt besser erträglich – aber das ganz grosze Publikum wird so vermutlich nicht erreicht.
Frau Dr. Kiupel wies mich darauf hin, dasz wohl keiner dieser Songs Hitqualitäten hat. Seufzend erinnerte sie an Musicals, die eben in diesen beschworenen 50er Jahren entstanden, wie etwa „My fair Lady“ (1956) und „West Side Story“ (1957), und bis heute fortleben, und das nicht nur in Music Halls. Sicher bedarf es einiger Zeit bis Musik sich im kulturellen Gedächtnis platziert.
Doch gleissende PR und Lautstärke verankern noch keinen Song, der einem noch auf der Barkasse nach weht. „Maria, ich kannte ein Mädchen Maria …“ An diesem Abend begruben Klanglawinen, mit hochverstärktem Schlagwerk und übrigem Instrumentarium, Erinnerungen an feinere musikalische Erzählungen, wie das Steigerlied oder Klagelieder der Protagonisten.
Wieviel Erfindung ein Musical verträgt, das in den biederen Fünfziger Jahren angesiedelt ist, fragte ich mich bei den wilden Rock’n Roll Darbietungen von Sohn Bruno, der auch noch Kommunist ist. Musiker und Kommunist (er ist ja auch vaterlos aufgewachsen). Das Motiv der Familien- und Nationalgeschichte kommt vertraut daher: was war ich (Sohn) früher anders und voll der Rebell! Das Musical-Unternehmen hat einen groszen Magen, es incorporiert alles Widerständige, alles einst Gegenkulturelle und mengt es in seinen Plunderteig. Wobei ich bei der Musik von Martin Lingnau eher von einer fetten rosaroten Sosze sprechen möchte, die erbarmungslos und gleichmäszig über alles rübergekippt wird. Es ist auch der Künstlerin Niki de Saint Phalle so ergangen. Janine van den Ende, Gattin des Senior Producers von Stage Entertainment International hat die Kunstsammlung kuratiert „Künstler von Weltruhm auf dem Boulevard vor den beiden Stage Theatern“ und eine Nana von Saint Phalle decoriert die Elb-Böschung.
1954 nahm der Hüftschwinger Elvis Presley in Memphis, Tenessee seine erste Platte auf und Schmalzlocke Bill Haley nahm „Rock around the Clock“ auf – aber das war im fernen Amerika. Und auch in der zweiten Hälfte der Fünfziger Jahre eine Musik die von einer Minderheit von Jugendlichen, den sog. Halbstarken gehört wurde. In Westdeutschland verkaufte sich 1954 am besten Heideröslein, Schwedenmädel, Anneliese und Oh, mein Papa. Eben das, was der Starclub-Betreiber Weissleder 1962 Dorfmusik nennen wird.
Fazit und Akrobatik
Ein letztes Mal Stage über Stage: „Musical-Kunst auf höchstem Niveau“.
Das Musical ist ein Kind von Zirkus und Varieté, nicht von Oper und Theater. Leichte Muse mit Hang zur Höhe, was die tolle, ja, wirklich, Akrobatik mitmeint.
Höhepunkt des Musicals ist das senkrecht aufgestellte Fuszballfeld, an dem die Tänzer schwebend zu agieren scheinen. (Sie sind angeseilt, Programmheft: „Vertikale Fußballakrobatik“, ausgeführt von BattleROYAL GmbH aus Berlin.) Spielen die sechs Tänzer nur die Deutschen oder auch die Ungarn? Ich war wohl zu beeindruckt, um es zu erinnern.
Die Tänzer können nicht stürzen – der ZuschauerIn kann es aber geschehen, wohlig im roten Plüschsessel sitzend. Den Kopf im Nacken fixiert sie den höchsten Punkt der Perfektion und der Bühnentechnik mit allen ihren Sparten. Um aber dem Inhalt und dem Sinn des Stückes nahe zu kommen, musz auf der Höhe, also der Tiefe des Orchesters gesucht werden; das soll die Fallhöhe verbildlichen zwischen der Perfektion der Musical-Kunst und dem dünnen Schwachsinn des Inhalts. Nur so kann der Verblödungszusammenhang ein gelungener sein.
(Geschrieben im Februar 2016)
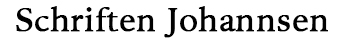

2 Kommentare