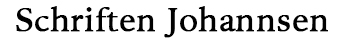Oder: Den Kopf verdrehen im Zoologischen Garten
– für Nele –
Das Tier trendet
„Lasz uns doch mal wieder in den Zoo gehen, irgendwo musz ich noch diese Gutscheine haben, Geburtstagsgeschenke, damals freute ich mich doch…“
„Ja, hast du.“
„Würdest du denn mitkommen?“
„Habe ich Bedenkzeit, bist du die Gutscheine wiedergefunden hast?“
Dies fragte Frau Pingel.
„Bedenkzeit, in der du vordenkst, welche Tiere du betrachten willst. Und so lernen wir uns besser kennen.“ Das empfahl Frau Koopman.
Bedenkerin Pingel stand in ihrem Buchladen und dekorierte den Tisch mit den Buch-Empfehlungen um. Auch und gerade in den groszen Shops wünschte die Kundschaft das. Das Persönliche: Ihre Buchhändlerin Erika Mustermann empfiehlt ganz besonders … Und dann zwei, drei handgeschriebene Sätze – es muszte ja nicht die eigene Klaue sein – mit Begründung und kurzer Inhaltsangabe.
Es war jetzt diese Woche nur ein neues Buch hinzugekommen, die Kollegin Musterschülerin (so nannte die Pingel sie für sich, die wiederum von der Kollegin auch für sich die Schnecke genannt wurde), griff ja grundsätzlich zu bei den Frei-Exemplaren. Hatte halt auch sonst keinen Lebensinhalt. Ob die Musterschülerin eigentlich ein „Trend-Gen“ hatte oder ob sie wg. ihrer Substanzlosigkeit einen Organismus so groszer Durchlässigkeit besasz, das die Hypes und Ins- und Outs und Moden und Trends nur so durch sie durchflossen, angemessen verlangsamt, so dasz sie Schilder aufstellen konnte. Bzw. immer genau wuszte, was Kundin Mustermann zu lesen wünschte. Das wurde dann nach vorn gepackt.
Erwartungsgemäsz war’s wieder ein Leichtgewicht eines bekannten Autors, ansprechend und entsprechend gestaltet. Beim Stapel-Packen, immer nur fünf, sonst sah’s ramschig aus, entdeckte Pingel ein Tier-Memory. Da gab es ein blau gestricheltes Faultier auf türkischem Grund vor Blättertapete. Und ein schwarz-weiszes comic-artiges Faultier auf blauem Grund. Untertitel: Nix erledigt und trotzdem fertig. Das könnte sie auch zu den Non-books neben die Kasse legen, als Impuls- oder Geschenk-Buch für die überforderte und gehetzte Kundin. Also praktisch für alle.
Vielleicht sollte sie noch eine Beziehung herstellen zu den Megatrends Minimalismus, Simplify your Live und Decluttering? Einfach-Leben-Bücher – die alte Beschriftung „Ratgeber“ hatte helle Spuren am Regal hinterlassen – füllten inzwischen die ganze rechte Wand neben dem Eingang. Wahrscheinlich hatte die Musterschülerin schon Buttons, T-Shirts, Plüschtiere und Sinnkarten-Postkarten mit den freundlich blickenden Maskenträgern bestellt. Bald schon müszte man den Krempel nachbestellen. Mit den Eulen war es seit Harry Potter nicht anders gewesen. Alpakas wurden von Social media in die Streichelzoos runtergeladen. Die Einhörner trendeten weiterhin – der bei weitem tierfreundlichste Trend.
Provokativ fragte Pingel die Trend-Kennerin: „Ist da jetzt das neue Signature-Animal? Oder ein emblematisches Tier? Oder ein Statement?“ Musterschülerin besasz die Gabe, durch Andere bis zum Horizont hindurchzusehen. „Es sind zweifellos charismatische Tiere. Und offenbar haben sie uns etwas zu sagen. Das geht bis zur Kapitalismuskritik.“ Die Belehrte schluckte hier herunter: „Sie verwechseln hier wieder mal was: Die Tiere sagen gar nichts. Menschen heben sie auf ein Schild, um irgendeinen Menschen-Mist auf sie draufzustrahlen. Wenn sie sie nicht gerade aufessen. Und dann ist das auch nur ein neuer Konsumtrend. Kapitalismuskritik mittels Warenfetisch.“
Sie sprach: „Es paszt jedenfalls zum offenbar weit verbreiteten Wunsch nach Verlangsamung. Faultiere sind ja nichts weniger als faul, den Namen täten sie heute sicher nicht mehr zugewiesen bekommen.“
Der Chef war argwöhnisch auf die miteinander redenden Angestellten aufmerksam geworden und näherte sich gewohnt jovial. „Sie wissen, wie sehr ich Ihre Kreativität schätze! Super, dasz Sie wieder Buchempfehlungen für uns haben!“ Kurzer erwartungsvoller Blick zur Kollegin, die in ihrer Freizeit nichts für das Unternehmen geleistet hatte. „Vielleicht können wir Ihre wundervolle Expertise nutzen, um eine Aktion oder ein kleines Event rund um das Faultier zu starten! Sie haben doch Biologie studiert, Frau Pingel.“
Alle wuszten, was jetzt kommen würde: „Abgebrochen.“
„Frau Krzeminski kann uns einen schönen Aufsteller malen.“ Der Chef war im Flow. „Und wie wäre es wieder mal mit Kids creative Afternoon, haha, also mit einer Malecke für die lieben Kleinen, ich frage meine liebe Frau, das lockt doch immer solvente Muttis in unsern Laden?“
Es blieb an ihr, an Frau Pingel hängen. Sie hatte sich wohl doch irgendwie aus dem Fenster gehängt. Die Musterschülerin schrieb weiterhin mit ihrer Drittklässler-Schrift ihre Buchempfehlungskärtchen, während die abgebrochene Akademikerin Pingel Sach- und Fachbücher zusammenschleppte und knackige kurze Zitate raussuchte, damit es die Kundschaft ins Buch hinein und dann zur Kasse hinzog. Die ewige Kunststudentin Krzeminski hatte so ein zwei-Meter-Kinder-Kindchenschema-Bild fabriziert. Winzige Öhrchen, kohlschwarze runde Äuglein, ein stumpfes Schnäuzchen, irgendwie grinsend. Viel Mühe hatte sie auf die Fellzeichnung von ocker über umbra von taubengrau bis pechgrau bis zu grünen federartigen Strichen verwandt.
Und die Pingel wagte es, darunter auch mal wieder dicke Bücher, bestellt direkt beim Verlag, zu plazieren.
Kalendersprüche, twittergängig, waren auch son ein Hype:
Der erste, den sie ausgedruckt hatte, erregte das Miszfallen des Chefs. „Ich brauche alle meine Zeit zum Leben, da bleibt zum Arbeiten nichts übrig.“
Zwei Sätze von dem Philosophen Friedrich Schlegel konnte sie aber unterbringen: „Warum sind denn die Götter Götter, als weil sie mit Bewusztsein und Absicht nichts tun – weil sie das verstehen und Meister darin sind?“
„Mit dem äuszersten Unwillen dachte ich nun an die schlechten Menschen, welche den Schlaf vom Leben subtrahieren wollen. Sie haben wahrscheinlich nie geschlafen und auch nie gelebt.“
Das war aus der „Idylle über den Müsziggang“ aus „Lucinde“, erschienen 1799.
Dazu paszten wundersam die gewichtigen Zoologie-Klassiker von Alfred Brehm und Bernhard Grzimek. Ihren Lieblings-Brehm Satz heftete Pingel dem Aufstellertier auf den Leib: „Bei Tage hört man von dem Faultiere höchstens tiefe Seufzer.“
Gänzlich verschiedene Faultiere, Bradypedidae, hingen fest in ihren Büchern. Jeweils die zwei- und die dreifingrigen Gattungen, die selten ihre Wohn- und Eszbäume verlieszen. Was ihr hier auffiel: Brehm und Grzimek waren beide Zoodirektoren. Und der eine ging mit seinem Schimpansen in ein Caféhaus, der andere führte einen Wolf an der Leine spazieren und hielt in der Wohnung Ozelots und andere Wildtiere.
Gutscheinbesitzerin Koopmann hatte die Gutscheine längst gefunden. Es gefiel ihr aber, von ihrer Freundin Klatsch aus dem Buchladen zu hören. Und noch mehr gefiel es ihr, aus Bemerkungen über Tiere etwas über die Freundin und die Beziehung der beiden herauszukristallisieren. Denn Frau Koopmanns Beruf war ein eintöniger.
Was sie sehen wollte: Giraffen, Fische (allgemein) und Chamäleons. Pingel sprach: „Also ich weisz jetzt, was wir uns zuerst angucken werden: das Zweifinger-Faultier, Choloepus didactylus.“
So wird es geschehen. Je weniger Action, desto mehr Gedanken. Je weniger Bewegung, desto mehr Kalorien-Ersparnis. Je weniger Auffälligkeit, desto besser der Schutz. Je geringer die Tätigkeit, desto gröszer die Polemik.
Von hinten sahen die beiden Frauen und sahen alle BesucherInnen wie Krallen oder Haken aus. „Guckmal, das Faultier guckt ja verkehrt rum!“ Überlassen wir es einem Kind, dies ausgerufen zu haben.
Nur für die Werbung sind die Knopfaugen oben und das putzige Schnäuzchen unten. Frau Pingel zu Frau Koopmann: „Kommen wir zu einem der interessantesten Details – das stand übrigens noch nicht im Brehm – auch das Fell wächst quasi „verkehrt herum“. So kann das Regenwasser besser ablaufen. Nein, wirklich! Und innen sind die Organe auch andersherum gelagert. In jeder Hinsicht perfekt angepaszt an die Umgebung. Es könnte den Kopf wenden um 180 Grad. Wie eine Eule. Aber wozu?“
Dieses und anderes wird vor dem Gehege mit dem hängenden Vielschläfer erzählt.
Der fast immer tätige „Thiervater“ – und seine hidden history
Im Mai 1850 sitzt der zwanzigjährige Alfred Brehm, Sohn eines Ornithologen-Pfarrers, also eines Vogelkundlers, der lebenslang als Pfarrer in einem thüringischen Dorf wirkte, am Nil fest. Dasz er hier dem Malaria-Erreger begegnete, erwähnt jede gewöhnliche Biographie. So müssen wir der Infektion gleich auch noch einen gewissen Raum geben.
Was aber gewöhnlich vernachlässigt wird, ist, dasz diese erzwungene Immobilität späterhin seine Einstellungen zu Bradypus tridactylus und Choloepus didactylus – in standarddeutscher Version FAULTIERE – prägen wird. Neben den historisch-politisch-sozialen Gegebenheiten, versteht sich.
Halten wir uns an die immer wieder kolportierten Fakten.
Fast fünf Jahre hat Brehm der Jüngere da schon den Nordosten Afrikas bereist. Übrigens trug der sehr berühmte Forscher-Vater im Gesicht ein Riechorgan, das dem Schnabel des Schuhschnabels, Balaeniceps rex, ähnelte.
Sohn Alfred hatte von ihm das Töten und Abbalgen und Präparieren von Vögeln gelernt. Vaters Sammlung umfaszte viele Tausend Exemplare, ordentlich beschriftet und sortiert. Sohn Alfred wird mit über 1.000 exotischen Vogelbälgen und zwei lebenden Affen nach Thüringen heimkehren.
Als sich für Alfred die Gelegenheit zu einer Afrika-Exkursion mit Baron Johann Wilhelm von Müller ergibt, bricht Brehm sein Architektur-Studium in Jena ab. Er wird es nicht wieder aufnehmen.
Auf der Reise zum Nil hatte er auf der Elbe von Dresden bis Prag ein Dampfschiff genommen, eine technische Neuheit damals. Zu Fusz ging es nach Wien, von da nach Triest und über das Mittelmeer. Das erste Mal sah der junge Mann da das Meer. In Alexandria ging die kleine Forscher-Reise-Gruppe an Land.
Gab es hier – Palmen, Staub und Sand, eine Zitadelle, Säulen-Relikte, Sphinxen – irgendetwas, das sich vergleichen läszt mit Jena oder Dresden oder Prag oder Wien? Brehm suchte Himmel und Wasser nach Vögeln ab.
Der Nil. Wasser von unbekannter Farbe. Der Flusz war ein Schauspieler: Hier schien er zu stehen und zu schweigen, hier gebärdete er sich wie toll, er gurgelte und schäumte. Und Richtung Khartoum flosz er durch eine Wüste, ein Flusz in einer Wüste.
Die schrägen Lateinersegel tanzen auf dem Strom wie flatternde Gänse. Sein Augenmerk galt nun einmal vor allem Ornis, den Vögeln. Er war sich nicht sicher, ob schon alle beschrieben worden waren. Wie geschmiedet erschienen sie ihm, die Flamingos und Reiher und Störche. Ihre Hälse sind Hieroglyphen. Und sie kamen in jedem Papyrus vor. Die Reiher und Störche hatten Verwandte in Europa, er klassifizierte und beschrieb und präparierte.
Es fehlte an allem auszer Zeit. Die Bücher kamen nicht. Nachrichten kamen nicht. Die Mittel nicht. Blosz Vögel, Himmel, Horizont. Und die dunklen Menschen hier, ein paar Brocken ihrer Sprache beherrschte er, das half ein wenig. Machte es etwas, dasz sie ihn nicht verstanden? Sie schienen auf nichts zu warten, ihr Leben ein ruhiger Flusz – wobei er nicht wuszte, welcher Flusz so wenig Temperament zeigte. Sicher, die Wärme. Die Fliegen. Er träumte sich fort, er sehnte sich nach Schlaf und fürchtete ihn zugleich.
Brehm sasz also fest am Ende seiner Reise, weil das Geld absprachewidrig ausblieb. Der Herr Baron hatte nichts geschickt. Wie sollte er da weiter forschen, geschweige denn leben. Auch die Munition war zur Neige gegangen.
Brehm zog sich bekanntermaszen an den Ufern des Nils eine Malaria-Erkrankung zu. Zu deutsch Sumpf- oder Wechselfieber genannt. In irgendeiner tropischen Nacht, die weder Abkühlung noch Dämmerung mit sich bringt, ohne schützende Kleidung oder engmaschige Netze trinkt eine Anopheles-Mücke von seinem Blut. Mit 55 Jahren wird er an der Krankheit sterben. Hohes Fieber, oft in regelmäszigen Abständen, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Übelkeit. Wuszte man damals schon, dasz die Stechmücke das todbringendste Tier der Welt ist? Die Brehm-Folgebände über Insekten erschienen erst im 20. Jahrhundert.
Damals gab es noch das fruchtbringende Nilhochwasser. Das Hochwasser, das die Hochkulturen hervorgebracht hatte. Der Nil damals: ohne Staustufen, ohne Brücken, ein Flusz ohne Beton-Bett. Ohne Stauseen und daraus resultierender Wasserstreitigkeiten.
Bei Khartoum im Sudan erleidet Brehm diesen erzwungenen Stillstand. Hier vereinigen sich der Blaue und der Weisze Nil.
Keine Patronen, der Ausgangsstoff der Vogelkunde. Immerzu waren die Vögel in Bewegung, gerade legte er auf einen Haubenzwergfischer an, verwandt mit dem Eisvogel der nördlichen Breiten. Ultramarinblauer Scheitel, schwarz gestreift. Nur 13 bis 14 Zentimeter grosz. Das war doch auch sein Leben und das seines Vaters. Manche schienen gar nicht zu schlafen. Manche schliefen im Flug, manchmal nur eine halbe Stunde am Tag und das auch abschnittsweise. Immer mal wieder versuchte Brehm seine Ruhezeiten zu reduzieren, um mehr forschen und notieren zu können. Aus seinen Aufzeichnungen würde er später sehr gern gelesene Artikel für eine sehr weitverbreitete illustrierte Zeitschrift machen, eine Art GEO des 19. Jahrhunderts, die „Gartenlaube“. (Vor 1880 ist die Zeitung übrigens fortschrittlich und liberal.)
Es wird sein eines wirtschaftliche Standbein. Das zweite war viel kürzer, also weniger lukrativ – „Das Thierleben“. Wieviel Tinte und Papier, Nächte und Fieberschübe das gekostet hatte. Ein gröszeres Schlafdefizit wird seine Frau Mathilde, geborene Reiz gehabt haben. Sie ist seine Mitarbeiterin. Und die Mutter seiner fünf Kinder.
Brehm lernte in Afrika für sich, dasz der für Menschen notwendige Schlaf auch portionierbar war. Es war alles eine Frage der Anpassung.
Wir schalten hier wieder in die Buchhandlung, in der gerade die Faultierwochen eingeläutet werden. Das lokale Anzeigen-Wochenblatt hatte für seinen redaktionellen Teil ein Interview mit dem Buchhändler geführt. Elegant nahm der alle Ideen seiner Mitarbeiterinnen auf und schwärmte von dem Faultier und wie sich die Sicht auf das „charismatische Tier“ im Laufe der Zeit verändert habe. Was sollten unsere Leser denn unbedingt wissen, haben Sie da ein schönes Bild für uns? Aber ja: „Bei Tage hört man von dem Faultiere höchstens tiefe Seufzer.“
Es gäbe auch einen schönen lokalen Bezug – wo heute ein jedem Städter bekannter Park zum Chillen einlädt, befand sich einst einer der ersten Zoos Deutschlands. Die Musterschülerin überzeugte die Pingel, die doch eigentlich zuständig war, auch Hamburg-Bücher mit historischen Aufnahmen in die Marketing-Aktion einzubinden und im Schaufenster mit zu präsentieren.
Zwölf Jahr später wird Dr. Brehm Zoodirektor in Hamburg. Die Familie Brehm zieht in das Direktoren-Haus im neuen Zoologischen Garten, gelegen nördlich des Botanischen Gartens. Hier leben 1864 bereits 1.200 Tiere aus 330 Arten. Ein Faultier ist nicht dabei. Hätte es die Besucher gereizt? Eher unwahrscheinlich.
Immer wieder wird Brehm zur Sparsamkeit angehalten. Einen echten Ankauf-Etat scheint es nicht zu geben. Die Kaufleute im Gründungskonsortium vertrauen auf Spenden:
„Schon gegenwärtig bietet die Bevölkerung des Gartens des Anziehenden und Unterhaltenden genug. Wir sind von dem Grundsatze ausgegangen, zunächst wenigstens gewisse Familien so vollständig als möglich zusammenzubringen, zumal solche, deren Mitglieder gern zu Geschenken benutzt werden. Und Geschenke erhält der Hamburger Garten mehr als jeder andere. Es verdient hervorgehoben zu werden, wie sehr jeder Hamburger, der in der Fremde lebt oder dort auch nur Verbindungen hat, bestrebt ist, dem Garten irgend ein Thier von fern her zuzuführen. Fast jedes Hamburger Schiff, welches von einer weiten Reise zur Heimath kehrt, hat für uns etwas an Bord. Wir dürfen ohne Uebertreibung behaupten, daß fast jeder Tag uns ein Geschenk bringt, durchschnittlich gewiß.“
So schreibt der Herr Direktor in seinem Kapitel „Bilder aus dem Thiergarten“ 1863 für die Familienzeitschrift „Gartenlaube“.
Brehm ist ein Mann der Emotionen und der heftigen Aufwallungen. Aus Hamburg scheiden die Brehms im Zorn, der Herr Direktor überwirft sich mit den Kaufleuten im Vorstand, die ihm Grenzen setzen wollen. Ein Zoo ist ein kommerzielles Unternehmen, was sonst.
Brehm will die Wissenschaft, die Anschaulichkeit und Aufklärung.
Ruhezeiten und Ruhe-Existenzen müssen ihm Anfechtungen gewesen sein. Das Kapitel über Faultiere (Bradypoda) in seinem Tierleben beginnt mit folgender Einordnung:
„Verglichen mit den bisher beschriebenen und den meisten noch zu schildernden Säugetieren erscheinen die Faultiere freilich als sehr niedrigstehende, stumpfe und träge, einen wahrhaft kläglichen Eindruck auf den Menschen machende Geschöpfe, gleichsam nur als ein launenhaftes Spiel der Natur oder als Zerrbild der vollkommenen Gestalten, die sie erschuf.
…, je undurchdringlicher das Dickicht, um so geeigneter scheinen solche Örtlichkeiten für das Leben der verkümmerten Wesen. Auch sie sind echte Baumtiere. Höchstens zu einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt, führen die trägen Geschöpfe ein langweiliges Stilleben und wandern langsam von Zweig zu Zweig.
… Auf dem Boden sind die armseligen Baumsklaven fremd. Ihr Gang ist ein mühseliges Fortschleppen des Leibes.“
Doch bei folgender Passage schien den so genannten Thiervater ein Reuegefühl anzuspringen. Oder sein Vorstellungsvermögen ist an eine Grenze gelangt. Oder er will, immer eingedenk der pädagogischen Rolle der Naturkunde, der Jugend keine falschen Beispiele bieten.
Weisz der Volksmund nicht: Nachts werden die Faulen fleiszig? Da musz das Faultier doch jedenfalls Nächtens irgendwas tun. Tatsächlich irrt Brehm hier. Faultiere sind sowohl tag- als auch nacht-aktiv. Sie schlafen nur 15 bis 20 Stunden am Tag, die Nacht mitgerechnet. Und bewegen sich anschlieszend nur so viel wie nötig. Brehm:
„Doch erscheinen sie träger, als sie es tatsächlich sind. Als Nachttiere bringen sie freilich ganze Tage zu, ohne sich zu bewegen; schon in der Dämmerung aber werden sie munter, und nachts durchwandern sie, langsam zwar, jedoch nicht faul, je nach Bedürfnis ein größeres oder kleineres Gebiet.“
„Man nennt sie harmlos, will damit aber ausdrücken, daß sie überhaupt geistiger Regungen nicht fähig sind. So tief indessen, wie die meisten Beobachter glauben machen wollen, stehen die Tiere nicht. Man pflegt zu vergessen, daß man in ihnen Nachttiere vor sich hat, über deren Fähigkeiten Beobachtung in den Tagesstunden kein Urteil gewähren kann. Das schlafende Faultier ist es, dem sein Name gebührt; das wach und rege gewordene bewegt sich in einem engen Kreise, beherrscht diesen aber genügend. Sein wenig entwickeltes Hirn bietet einem umfassenden Verstande oder weitgehenden Gedanken und Gefühlen keine Unterlage; daß ihm aber Verständnis für seine Umgebung und die herrschenden Verhältnisse abgehe, daß es weder Liebe noch Haß bekunde, weder Freundschaft gegen seinesgleichen noch Feindschaft gegen andere Tiere zeigt, daß es unfähig wäre, in veränderte Umstände sich zu fügen, wie man behauptet hat, ist falsch.“
Brehm ist im Gegensatz zu seinem Pfarrer-Vater von Darwins Evolutionslehre überzeugt. Stellen wir uns eine riesige Zirkus-Arena vor, zugleich ein Familien-treffen, ferne und nahe Verwandte, Menschen und andere Säugetiere im inneren Rund. Irgendwo wohnt wohl auch ein Zirkusdirektor, der die Leitung abgegeben hat, der schaut und manchmal lacht. Im Tier- wie im Menschenreich gibt es Rangordnungen.
Brehm ist einer der ersten Zoologen, der das Verhalten der Mitgeschöpfe beschreibt. Die Mängel sind doch benennenswert – „Anfangs scheint es, als betrachte sie (die Faultierin/ die Faultiermutter) ihr Kind mit großer Zärtlichkeit; doch die Mutterliebe erkaltet bald, und die stumpfsinnige Alte gibt sich kaum die Mühe, ihr Kind zu füttern und zu reinigen oder ihm andere Ammendienste zu leisten.“
Brehm spricht vom Artensterben und von Biodiversität in seinen Worten.
Das schlichtes Nutzdenken, das auch das Verhältnis Mensch | Bradypodae bestimmt, ist der Einstieg ins Verschwinden. Brehm schlieszt das Faultier-Kapitel folgendermaszen:
„Der Nutzen, den die Faultiere den menschlichen Bewohnern ihrer Heimat gewähren, ist außerordentlich gering. In manchen Gegenden essen Indianer und Neger das Fleisch, dessen unangenehmer Geruch und Geschmack den Europäer anekeln, und hier und da bereitet man aus dem sehr zähen, starken und dauerhaften Leder Überzüge und Taschen. Schaden können die Tiere nicht verursachen, da sie in demselben Maße verschwinden, als der Mensch sich ausbreitet. Jeder Ansiedler im Urwalde aber verdrängt schon durch sein Erscheinen, durch das Fällen der Bäume die Faultiere, die sonst dort gehaust haben; und der frevelnde Mutwille des Jägers trägt redlich dazu bei, sie auszurotten.“
Offen musz bleiben, ob Brehm es selbst gehört hat oder sich auf Hörensagen bzw. Lektüre verlassen muszte: „Bei Tage hört man von dem Faultiere höchstens tiefe Seufzer.“
Der Fernsehonkel und sein „Tierleben“
Wir schalten uns einhundert Jahre später wieder ein. Erstes Programm. Die Sendung hiesz „Ein Platz für Tiere“ und der Platz der Tiere, die neben dem Frankfurter Zoodirektor Dr. Bernhard Grzimek auftraten, und ihn an die Wand spielten. Sie saszen auf seiner Schulter, lagen auf seinem Schreibtisch oder posierten vor schlichter Studiowand. Tiere aus seinem Zoo, den er in völlig zerstörtem Zustand bereits am 1. Mai 1945 übernahm und kurz darauf eröffnen konnte. Gerade mal 12 Zoo-Tiere hatten den Krieg überlebt.
Wir schalten hier wieder in den Buchladen von Frau Pingel, der Kollegin Musterschülerin und dem Chef, der so gut zu motivieren wuszte. Gut machte sich der Aufsteller, den die Aushilfe Krzeminski gemalt hatte. Schon am zweiten Tag der Faultier-Wochen, die jede Woche mit einem anderen Slogan Lese- und Kauflustige in den Laden lockte – jetzt war es gerade: „Geben Sie Ihrem inneren Faultier Raum!“ – bemerkte die Musterschülerin, dasz bei der Baby-Boomer-Generation bei der Erinnerung an den kuriosen Tierfreund und seine possierlichen
Tiergäste alle Augen leuchteten. Die Talkshow war noch nicht erfunden. Daran liesze sich doch anknüpfen. Sie selbst war Massenmedien-abstinent grosz geworden. „Du, Andy“ wandte sie sich an den Chef, „ich hab hier mal einen Aufschlag gemacht: am Faultierbaum wird ein Screen integriert – mit wechselnden Bildern vom Tieronkel Grzimek am Schreibtisch und vor Vorhang, seine Tiere präsentierend. Das kennen alle und dann fällt ihr Blick auf die und die Bücher.“ Andy schmunzelte und wollte das mal mitnehmen.
„Guten Abend, meine lieben Freunde (manchmal auch: meine Damen und Herren,) ich habe ihnen heute (ein Tier) mitgebracht.“ Souverän, leicht pastoral und leicht nasal moderiert er ab 1956 insgesamt 31 Jahre zur besten Sendezeit, die unterhaltend-lehrreiche Sendung. Anfangs schwarz weisz, dann bunt. Einschaltquoten lagen bei 70 Prozent. Hatte er jemals ein Faultier dabei? Schwer vorstellbar – denn ein Faultier macht weder Show noch Action. Ich korrigiere: in der gut recherchierten Grzimek-Biographie von Claudia Sewig aus dem Jahr 2009 wird ein Faultier als Studio-Gast erwähnt. Biographin Sewig brachte viele unsympathische Details aus dem Leben des Zoodirektors und Naturschützers ans Licht. Buchhändlerin Pingel bestellte vorsichtshalber nur ein einziges Exemplar von „Der Mann, der die Tiere liebte.“ Leider in der Biographie nur diese eine Erwähnung. Hat Grzimek das Tier genötigt? Es im Arm gehalten? Oder in Ruhe an einem Tonarm hängen lassen?
Hier braucht es ein kluges Buch, mindestens also ein Kinderbuch, das die Geschichte aus der Sicht der Tiere erzählt. Nachts im Zoo: Okapi und Beutelratte tauschen ihre TV-Erfahrungen aus, nachdem sie in dunkler Kiste in eine helle Studio-Welt verschleppt wurden. Wie ging es Dir da?
Anders als Brehm war Grzimek äuszerst geschäftstüchtig und arbeitete an seiner Karrierre. Er tat es natürlich für die Natur, für einen Platz für Tiere in Zoologischen Gärten – vor allem aber in Afrika. Eine Aussage aus seinem später Oscar prämierten Film „Serengeti darf nicht sterben“ von 1959/60 löste einen Skandal aus: Grimek hatte leidenschaftlich für den Erhalt der Landschaften und den Artenschutz plädiert und ihre Bedeutung gleichgesetzt mit Gotischen Domen, ja, die Natur als gemeinsames Erbe der Menschheit bezeichnet. Er wurde aufgefordert, den Satz herauszustreichen. Es handele sich um unzulässige Gleichsetzung von Tieren mit Menschen.
Im Alter war Grzimek verbittert darüber, wie wenig er erreicht hatte. Und das nach einem so arbeitsreichen Leben mit vielen Reisen, Verhandlungen (auch mit afrikanischen Despoten), Aufklärungs- und Aufdeckungsarbeit im Sinne der Tiere. Niemals wäre ihm das möglich gewesen, wenn er die amerikanischen Besatzer in Frankfurt nicht belogen hätte. Er wäre nicht Zoodirektor geworden. Dieser Posten war Homebase und Reputationsbasis seines Lebens.
Aufgedeckt wurde erst etwa zwanzig Jahre nach seinem Tode, dasz er sowohl in der SA als auch in der NSDAP war.
Wenn Grzimek altersweise sprach: »Es wäre besser um die Welt bestellt, wenn die Menschen sich untereinander wie Löwen benähmen«, dachte er da an ein unerlöstes Faultier tief in seinem Inneren? Der männliche Löwe, ganz überwiegend dösend, ruhend, schlummernd, schlafend, chillend während die Löwinnen die Jagd und die Jungenaufzucht auf die Pfoten stellen? Seien wir auch altersweise und einigen uns auf diese Lesart.
Und hören wir nun zum Abschlusz – liebe Freundinnen – was ich Ihnen mitgebracht habe aus „Grzimeks Tierleben“. I. Akt: das Faultier tritt auf – Leben im natürlichen Habitat. II. Akt: Das Zweifinger-Faultier im Zoo. Das Dreifinger-Faultier nicht. III. Akt: Fortpflanzung und Aufzucht
„Zögernd, bedächtig und mit zeitlupenhaften Bewegungen hangeln graugrüne, unscheinbare Bündel durch das Geäst des tropischen Regenwaldes, den Bauch nach oben und den Rücken nach unten gekehrt, ziehen sie – Nachtwandlern gleich – von Baum zu Baum. Aufgrund dieser einmaligen Fortbewegungsweise, die in ihrer Langsamkeit für uns die Parodie einer Bewegung ist, haben wir diese Lebewesen Faultiere genannt. „Ihre Trägheit ist eines der Naturwunder“, sagt ein amerikanischer Zoologe, „der Zellsaft eines Einzellers strömt schneller (?) als ein Faultier vor einer Boa flieht.“ Kommentar W.J. Jede mühevolle Nahrungssuche bleibt den Faultieren erspart. Da ihre langen Arme und Beine mit großen gebogenen Krallen versehen sind, können sie sich in den Zweigen fest verankern und wie in einer Hängematte die Vorteile des üppigen Pflanzenwuchses mit Gelassenheit genießen; Blätter, junge Triebe, Blüten und Früchte wachsen ihnen förmlich in den Mund. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, sich rasch zu bewegen – im Gegenteil, gerade durch ruhiges Verhalten sind sie vor ihren Feinden am besten geschützt. Die Natur hat sie darüber hinaus mit einem einzigartigen Haarkleid ausgestattet …“. (zit. n. Grzimeks Tierleben – Enzyklopädie des Tierreichs, Säugetiere 2, Zürich 1968, S. 181f)
II. Akt: Das Zweifinger-Faultier im Zoo. Das Dreifinger-Faultier nicht.
„Schon seit Jahrzehnten sind die Zweifinger-Faultiere dankbare Pfleglinge in vielen Zoologischen Gärten. Sie sind in ihrer Nahrung weniger einseitig als die Dreifinger-Faultiere und gewöhnen sich schnell an pflanzliche Mischkost, auch gekochte Eier nehmen sie gern. Durch mehrfache Zuchterfolge in jüngerer Zeit im Prager Zoo und im National Zoological Park Washington haben wir Einblicke in Geburt und Jungenaufzucht bei den Zweifinger-Faultieren bekommen. Ein Unaupärchen, das über fünfzehn Jahre im Prager Zoo lebte, war sehr zahm. Bei der Fütterung kletterten die Tiere ihrem Wärter entgegen und nahmen Salat, gekeimten Weizen und Obst aus seiner Hand. Männchen und Weibchen sind schwer zu unterscheiden, die Hoden sind äußerlich nicht sichtbar. Es gibt wahr-scheinlich keine festen Brunstzeiten, denn außer April, September und November wurden in Prag und Washington in allen Monaten des Jahres Geburten verzeichnet. Bei der Paarung haken sich die Tiere nur mit den Armen an einem Ast fest und drehen sich mit den Gesichtern zueinander. Als Tragzeit gibt Zdenek Veselovsky fünf Monate und zwanzig Tage an. Auch die Geburt vollzieht sich im Kletterbaum. Häufig hängt das Weibchen dabei sogar ausgestreckt, nur mit den Armen verankert. Das vollentwickelte Junge wird ohne Keimhüllen mit dem Kopf voran geboren. Unter heftigem Atmen beginnt es sofort selbst bei der Austrei-bung mitzuhelfen, bis es ich mit den Krallen an der Mutter festhalten kann. Im Zoo von Washington wurde beobachtet, wie andere im selben Gehege gehaltene Unaus sich dicht an die Mutter drängten, vielleicht, um ein Herunterfallen des Neugeborenen zu verhindern. In Freiheit leben jedoch Zweifinger Faultiere wie auch alle übrigen Arten als Einzelgänger. Während des Geburtsvorgangs, der fünfzehn bis dreißig Minuten dauert, leckt das Weibchen sein Junges, auch seinen eigenen Bauchpelz, an dem das Kind selbständig zu den Zitzen klettert. Erst nachdem die Nabelschnur durchgebissen ist, zieht das Weibchen die Beine an.
Das Neugeborene ist etwa 25 Zentimeter groß, dreihundert bis vierhundert Gramm schwer, sein wolliges Fell ist auf dem viel dunkler gefärbten Rücken eineinhalb Zentimeter lang, die Augen sind geöffnet. Das Gebiß ist vollständig. (…) In den ersten vier Wochen bleibt das Faultierkind im Fell der Mutter, die sich in dieser Zeit kaum bewegt, verborgen. Erst dann beginnt es, sich für seine Umwelt zu interessieren; es löst die Handkrallen aus dem Pelz der Mutter, um nach nahen Zweigen zu greifen und alles Erreichbare zu beschnüffeln. Die Mutter trägt es beim Hangelklettern umher und geht recht achtlos mit ihm um. Berührt jedoch beispielsweise ein Mensch oder ein anderes Faultier das Junge und stößt das Kind einen kurzen hohen Schrei aus, so reagiert sie unverzüglich und beißt sogar, falls der Störenfried sich nicht zurückzieht. (…) Mit zehn Wochen beteiligt sich das Kind erstmals an den Mahlzeiten der Mutter, hält sich aber dabei mit den Beinen noch an ihr fest. Erst mit neun Monaten versucht es, auf eigenen Beinen zu stehen, richtiger gesagt, an den eigenen Haken zu hängen. Jeder Versuch, zur Mutter zurück zu kehren, wird von ihr sehr entschieden abgewehrt. (…)
Die Dreifinger Faultiere waren immer nur flüchtige Gäste in den Zoologischen Gärten. Als einseitig angepaßte Blattesser sind sie vergleichbar mit den australischen Koalas, deren Haltung in europäischen Zoos ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten macht. (…)
Das Männchen beteiligt sich in keiner Weise an der Jungenaufzucht. Auch die Mutter scheint ihr Kind beim Klettern häufig zu vergessen, denn das fest an ihre Brust geklemmte Jungtier findet oft keinen Platz zum Ausweichen. Ganz auf sich selbst gestellt, ist es unverwandt auf der Hut, und im Augenblick, wo ein Ast es von der „aufwärtsstrebenden Mutter“ wegzuzerren droht, läßt es sie los, krabbelt, (…) außen um das Hindernis herum und langt blitzschnell nach oben, um auf den durchfahrenden Zug wieder aufzuspringen.“ (zit. n. Grzimeks Tierleben – Enzyklopädie des Tierreichs, Säugetiere 2, Zürich 1968, S. 185f )