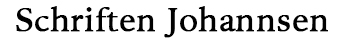Auf der Reise in Landschaften der Empathie nimmt der Text das Verkehrsmittel Bus, Literatur, sucht den Ort eines KZs auf und ein Labor, in dem wissenschaftlich nach der Ausnahme Mitleid, diesem erklärungsbedürftigen Phänomen, gesucht wird. Schlieszlich halten wir inne, in der Hand, wie ein Ticket, die gefundenen Wörter. in der Hand, wie ein Ticket, die gefundenen Wörter. Empathie, Mitleid, Mitgefühl. Und Sympathie?
I. Im Bus der Elbe entlang und auf dem Weg zur Maske
Ein Bus bringt Menschen von dort nach da, von Z nach A, von arm nach reich, die geneigte Leserin mag sich hier Stadtquartiere mit wenig Wohnraum pro Bewohner und in privates Grün gebettete Einzelhäuser vorstellen. Ein Bus versammelt fahrplanmäszig Un-Identisches, befördert Individuen, die im Anderen ein Anderes sehen, was zumeist nach rascher Augenwinkel-Scannung erfolgt. Der Bus ist nicht voll. Wer nicht ins eigene mobile Endgerät blickt und sich eingehegt ortlos macht, passiert Elbstrom, Containerterminals, weisze Villen und auf der Buseinstiegsseite Parkkulissen, hinter denen uneinsehbar, nummeriert und namenlos alte Anwesen vermutet werden. Neue, denen die Handschrift der Investoren anzusehen ist, ersetzen sie mehr und mehr.
Moritz, nennen wir ihn Moritz, fährt täglich mit dem Bus über die feinste Hamburger Verbindung, die den Strom mit der einst noblem französischem Bezeichnung für Strasze kombiniert. Sein Blick fällt auf bekannte und unbekannte Gesichter, er unterscheidet zwischen Passanten, die einem Blickkontakt standhalten und denen, deren Augen weiter fahren, achtlos Abfuhr erteilend.
Das denke ich mir – ich bin Gast, ich bin nur selten hier, ich weiche Moritz nicht aus wie einer flüchtigen Bekannten im vorderen Busbereich, die gerade mit ihrem Gepäck beschäftigt war; es entspinnt sich ein Gespräch über Fahrpläne, Verkehrsaufkommen und Anschluszmöglichkeiten, das ich nicht vorantreibe. Moritz‘ Worte kommen einzeln aus seinem Mund, nach einigen Sätzen fragt er mehrfach, ob er etwas fragen könne. Ein Ritual zum Einsteigen, die Fixierung der Grenzen scheint der Gästin zu obliegen. Ich steige vor ihm aus, er wünscht mir auf eine Weise alles Gute, die mich an eine Segnung denken lassen.
Beim Aussteigen begegne ich der Bekannten, nennen wir sie Frau B. Wir haben ein Stück gemeinsamen Weges vor uns. Bevor ich auf ihre Einkäufe, verwahrt in steifen Papiertaschen, zu sprechen kommen kann, gibt sie ihrem Erstaunen Ausdruck, dasz ich mit dem Mann im Rollstuhl, dessen Anblick ihr vertraut scheint, ein Gespräch geführt habe, da dieser doch geistig behindert sei. Zur Sprechweise von Frau B. musz gesagt werden, dasz sie (quasi) immer einen Text spricht, sie spricht jede Silbe, wie sie es vor langer Zeit gelernt hat, wie sie es Jahrzehnte auf der Bühne tat. Mein Part ist es, ihr zu widersprechen und den auf der Elbchaussee stattgefundenen Austausch zu einem normalen Gespräch zu erklären. Ich erinnere nicht, hierbei das Wort „normal“ verwendet zu haben. Nun setzt Frau B. die Situation, in der sie sich zu ihrem Glück nicht befunden hat, in ihren Wahrnehmungs- und Erfahrungszusammenhang. Stets setze sie sich an die Stelle von Personen, nehme deren Sprache und Welt an, das habe ihr Leben auf der Bühne schlieszlich ausgemacht, das sei eine Last und dies in diesem Falle um so mehr, da es sich um ein so bedauernswertes Leben handele, ein Leben im Rollstuhl. Sicher auch ein Leben in groszer Einsamkeit.
Mein Part ist es wiederum, ihr zu widersprechen, ich traue meinen Worten selbst nicht, behaupte, dasz es doch sicher ein gutes Leben sei, nicht, weil ich meine, es zu kennen, vielmehr aus bloszem Reflex gegenüber Frau B.s Anmaszung. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Zwei Mut- oder Anmaszungen über einen Anderen treffen aufeinander, von denen die von Frau B. doch ganz offensichtlich die emotionalere und einfühlendere ist. War nicht meine Zuwendung zu M. auch voller Herablassung, nur möglich durch den festen Fahrplan und die Abwesenheit von anderen Occupationen? Hat Frau B. nicht die Situation besser erfaszt, indem sie einen „armen Krüppel“ auf imaginärer Bühne erscheinen läszt, der das groteske Andere vorführt und Abscheu und Mitleid freisetzt? Gefühle, die sich, einmal verbalisiert, nun an die anhaften, die sie aussprach. Ich bin froh, mich von Frau B. wieder verabschieden zu können.
II. Das Mitleid und die Literatur
Das Kind, das ich war, wuchs auf in sicheren und biederbürgerlichen Vorstadt-Verhältnissen, die Eltern hatten sich gerettet auf eine bescheidene Wohlstands-Insel und ihre beschädigte Jugend, ihre Scham, ihre verleugnete Angst und den Hunger mitgenommen, das Abwesend-Anwesende einer Nachkriegskindheit. Eine schallschluckende Rupfen-Tapete in allen Häusern, Jahrzehnte später entdeckt das gewesene Kind, dasz es andere Wände und andere Schweige-Geschichten gab. Eine Suppenterrine steht auf dem Tisch, Mutter trägt Schürze, der Vater Aktentasche, der Couchtisch aus Teakholz, wen interessiert das. Ein Wort leuchtet für das Kind auf, den Widerschein liest die heutige Person noch immer, es war Titel und Orts eines Gedichtes, das das Schulkind auswendig lernen musz. Der Klang des Wortes, des Gedichtes und der Ort eines Schlachtfeldes. Viel später realisiert sie, dasz es eine Stadt an der Elbe ist, nicht weit von Prag. Das Wort ist Lieblingswort und Schreckenswort, es ist Leuchtschrift eines groszen Krieges für das kleine Kind, Krieg aller Kriege, wie sinnlos die Differenzen sind. Kolin. Kolin, verortet in einem gräszlichen Osten, doch bewohnt von Menschen, die ganz nahe rückten. Mit den Menschen der Ballade, das Kind darf, nein musz laut sprechen, deklamieren heiszt es, empfindet sie Mitleid.
„Und mancher kehrte nicht nach Haus/ Einst von Kolin.“
Kolin ist dreckig und irgendwie groszartig.
„Der Tod in seinen Arm ihn zwang“, was war die Vorstellung des gewesenen Kindes, hatte sie eine vom Tod? „Kolin. Mein Sohn verscharrt im Sand: wer weisz wo.“ Sie erinnert die Zeile und den eigenen Kummer über das Unwissen des Vaters über das Grab des Sohns. Alles muszte doch seinen Ort haben. Kolin. Das Gedicht nach über vier Jahrzehnten lesend, erstaunt sie das Ende des Liedes vom Krieg. Der Dichter Detlev von Liliencron legt sich gedanklich neben die Grenadiere und Junker: „Doch einst bin ich, und bist auch du/ verscharrt im Sand, zur ewigen Ruh,/ wer weisz wo.“ Das hat sie nicht gemeint. Es bleiben die Orte.
Kolin war Schauplatz einer Schlacht zwischen dem Emporkömmling Preuszen unter Friedrich II und den Kaiserlich-Habsburgischen Truppen am 18. Juni 1757. 22.000 Männer kehrten nicht heim. Es war die erste Niederlage Preuszens im Siebenjährigen Krieg, der 1756 beginnt. Also den Friedrich II mit dem Einmarsch in Sachsen beginnt. In Preuszen nannte man den Krieg gern den Dritten Schlesischen Krieg.
Lernen heiszt Zusammenhänge entdecken: Kolin ist ein blutiger Fleck auf der Landschaft eines Krieges, der ein Weltkrieg war. Vom groszen Morden des 20. Jahrhunderts unterschied der Krieg sich in der mentalen und materiellen Ausstattung der Soldaten – die gern archaisierend „Krieger“ genannten Soldaten der Vater und Groszvatergeneration zogen mit einem ewig dienenden, leutseligen und unbesiegten Groszen Friedrich in fremde Länder. Ich wähle Kolin als Chiffre für Kriegs-Angst und -Schrecken. Das so weich tönende Kolin umhüllt die eigene kleine Angst, ist ein Grünsprosz in schwarzem Tuch. Ein erstes Mitleid mit dem Vater, der seinen Sohn verlor, regte sich.
Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.
Der apodiktische Satz über Mensch und Mitleid wurde gedacht und geschrieben im ersten Jahr dieses ersten Weltkrieges. Der Krieg griff, wie banal und furchtbar, direkt in das Leben der kleinen Leute ein, mit Armut, mit Not, mit Hunger – und einer der 1756 den Verlust der Reisehoffnungen und –Pläne mit „Dank sei dem König von Preuszen!“ quittierte (so Gotthold Ephraim Lessing am 1.10.1756 aus Leipzig an Moses Mendelssohn), muszte seine Europareise abbrechen. Zuvor zog Lessing des Theaters wegen von Berlin nach Leipzig, wollte sich aber mit einem Freund die Welt besehen. Nun reflektiert der edle Jüngling – er ist noch keine 30 – gemeinsam mit Freund Nicolai (1733 – 1811) und Freund Mendelssohn (1729 – 1786) über die Natur des Trauerspiels. (Ein einzigartiges Dokument der Diskussion der Leidenschaften im 18. Jahrhundert. Der Briefwechsel erschien übrigens nicht zu Lessings Lebzeiten.)
„Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.“ Lessing schreibt es aus Amsterdam an Nicolai im November 1756. „Zu allen Zeiten und unter allen Gestalten.“ „Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.“ Der Kontext des Satzes folgt. Was will ich mit dem Satz? Ist die Behauptung nicht ebenso hilflose Abrede gegen die regierenden Realien wie Einladung zur Demontage eines Glanzbildchens? (Auf dem Glanzbildchen: weibliche Gestalt greinend an Gräben oder Gräbern.) Der Satz bleibt stehen. Gestickt auf Leinen, projiziert auf
die Wand eines Geschäftshauses.
Nun die Passage aus dem Brief:
„Wenn es also wahr ist, daß die ganze Kunst des tragischen Dichters auf die sichere Erregung und Dauer des einzigen Mitleidens geht, so sage ich nunmehr, die Bestimmung der Tragödie ist diese: sie soll unsre Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren, gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mitleid zu fühlen, sondern sie soll uns weit fühlbar machen, daß uns der Unglückliche zu allen Zeiten, und unter allen Gestalten, rühren und für sich einnehmen muß. Und nun berufe ich mich auf einen Satz, den Ihnen Herr Moses vorläufig demonstrieren mag, wenn Sie, Ihrem eignen Gefühl zum Trotz, daran zweifeln wollen. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmut der aufgelegteste. Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhafter, und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses (…).“
Die Schrift Mendelssohns, aus der Lessing zitiert, war 1755 unter dem Titel „Über die Empfindungen“ erschienen.
Die „Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück“ schreibt Lessing nach dem Krieg. Listig: er nennt es „Lustspiel“. Und er datiert es auf das Jahr 1763, das Kriegsende – da beginnt er wohl die Niederschrift des Dramas.
Zwischen den beiden Hauptpersonen, von denen wir Anlasz haben, anzunehmen, dasz sie einander lieben, allerhand Schutt aus Miszverständnis, Männer-Ehrgefühl und Kriegslast. Ein degradierter Major, kriegsversehrt und verarmt, da er mitleidig an der Zivilbevölkerung Sachsens handelte. Mitleidig oder blosz anständig, es gerät ihm zum Schaden in der Bühnenhandlung und zum Vorteil in den Augen des Fräuleins von Barnhelm, einem starken und klugen Frauenzimmer.
„Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.“
Mendelssohns Diktum variiert Lessing in seinen Hamburger Jahren 1767 – 1769 in der „Hamburgischen Dramaturgie“, diesem Meilenstein der Kritik, diesem Leuchtturm der Aufklärung. Es ist tatsächlich in Hamburg verfaszt worden!
Auch das sei zitiert. Das Projekt Nationaltheater, der „süsze Traum“, wie Lessing an Freund Gleim rückblickend schreibt, ist da wohl schon gescheitert.
Die Theoriebildung baut Lessing auf Aristotels starken Schultern auf. Sein Tragödiensatz – die Tragödie ziele auf Erregung und Reinigung der Leidenschaften – ist eine Art erstes Buch Moses der Reflexion über das Theater.
Unter dem Datum des 19. Januars 1768, dem „Fünfundsiebzigstem Stück“ schreibt Lessing:
„(…) Es beruhet aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles von dem Mitleiden gemacht hat. Er glaubte nämlich, daß das Übel, welches der Gegenstand unseres Mitleidens werden solle, notwendig von der Beschaffenheit sein müsse, daß wir es auch für uns selbst, oder für eines von den Unsrigen, zu befürchten hätten. Wo diese Furcht nicht sei, könne auch kein Mitleiden stattfinden. Denn weder der, den das Unglück so tief herabgedrückt habe, daß er weiter nichts für sich zu fürchten sähe, noch der, welcher sich so vollkommen glücklich glaube, daß er gar nicht begreife, woher ihm ein Unglück zustoszen könne, weder der Verzweifelnde noch der Übermütige, pflege mit anderen Mitleid zu haben. (…) Es käme darauf an, die Handelnden auf der Bühne uns unten ähnlich zu machen. Aus dieser Gleichheit entsteht die Furcht, daß unser Schicksal gar leicht dem seinigen ebenso ähnlich werden könne, als wir ihm zu sein uns selbst fühlen: und diese Furcht sei es, welche das Mitleid gleichsam zur Reife bringe.“
Die Gleichheit eine Schwester der Empathie. Diese Schwestern sollte der Mensch nicht trennen.
III. Mit wem?
„Am Ort des gröszten Verbrechens in Norddeutschland“, ich höre mich das sagen, hier, wo jeder Satz ein Zitat ist, auf diesem so aufgeräumten Gelände, dieser Gedenk-Stätte, die sich von allen Orten der Welt am meisten von einem Konzentrations-Lager unterscheidet, wo die sich hier bewegenden Besucherinnen und Besucher sich den einst hier Handelnden, den Behandelten auch, nahe fühlen mögen. (Mögen heiszt Wollen und Sollen.) Oder betrifft das nicht eher die Besucherinnen und Besucher: kein gröszerer Unterschied als der zwischen Gedenkstätten-BesucherIn und Häftling?
Das Bild eines Magneten, ein Hufeisen, schwarz und rot, Eisenspäne werden angezogen, ein Bogen spannt sich.
Mag sein, dasz Orte und Plätze eine Anziehungskraft ausüben. Das ist hier nicht der Fall – das meine ich, die ich in einer Konzentrationslager-Gedenkstätte als Vermittlerin arbeite. Was aber anzieht, sind Geschichten über Menschen. Ist es gleich, ob sie gelebt haben oder ob sie imaginiert sind? Ob sie gut oder böse? Menschen jedenfalls, zu allem fähig.
Es gibt einen Abzweig über die Technik der Vernichtung: wie lange lebte ein Häftling, Zeiträume und Daten, Organigramme von SS und der von der SS so genannten „Häftlingsselbstverwaltung“ und andere Wissensbrocken. Das ist etwas zum Nachhausetragen, zum Ablegen, zum Vergessen. Die Vermittlerin verfügt über eine gediegene Sammlung von Details und Fakten. Erfahrungs-gemäsz lassen sich Details besser repetieren und intern archivieren, wenn es Zusammenhänge und eine Logik gibt. Die mitgebrachte Logik versagt bereits bei der Idee der Vernichtung durch Arbeit. Ein Bild: Zusammenhänge liegen da wie Blätter in einem Kartenspiel. Einzeln gespielt stechen sie die anderen. Und so säuberlich liegen sie da, tragen grosze Namen wie Rassismus, Genozid, Ausbeutung, kap. Verwertungslogik, Uniformen, dasz die zu erzählende Geschichte zu einem Hintergrundpanorama werden kann, zu einem beliebigen Schrecknis.
Wir müssen die Geschichten neu erzählen.
Die jugendlichen Besucher möchten den leeren Raum zwischen den Steinhaufen („Gabionen“), den Hinweistafeln, den Rekonstruktionen und angeblichen, unglaubwürdigen Originalbauten mit historischem Personal bevölkern. Mit Tätern und Opfern und am besten mit einem Dutzend Subjekten in dem Raum dazwischen. Es scheint, als ob die Sachwalter des Ortes das Gegenteil wollen, sie nennen alles „ehemalig“, ehemaliges Krematorium, ehemalige Fabrik, sie trauen dem allgemeinen Ehemaligkeitsanspruch der Geschichte nicht.
Der und die Täter erregen mehr die Phantasie, erzeugen mehr Spannung als die Häftlinge. (Erfreulich unmodern der Ausdruck SS-Schergen.) Mit Ambivalenz konstatiere ich eine Nähe der Besucherinnen und Besucher zu ihnen. Eher zu den Besuchern als den Besucherinnen. Langweilig und erwartbar die gängigste Annahme die SS-Männer betreffend. „Sie muszten das tun.“ Auf bislang unerforschte Weise überträgt sich diese Fehlannahme feinstofflich von einer Generation auf die nächste, ohne dasz es zu einer direkten Kommunikation kommt. Die häufigste Frage der Jugendlichen über die SS-Männer ist jedesmal neu, ist jedesmal Gesprächs-Eröffnung:
„Hatte nicht einmal ein SS-Mann Mitleid mit den Häftlingen?“
Sprechen über Mitleid ist ein Sprechen über sich selbst. Hier ist es sprechen über eine als Als-Ob-Erfahrung an einem Ort, von dem sich Besucher eine Erfahrung „wie damals“ versprechen, ein Hineinschlüpfen in die Häftlings-Rolle, von der sie wissen, dasz sie komplett unerträglich ist. Die Frage nach der Mitleids-Fähigkeit der Täter ist die nach dem eigenen Mitgefühl, gesehen durch die Augen des Täters, und verrät ein hohes Masz an M.-Fähigkeit. Diese ist wohl nicht einfach da, ist kein Teil der menschlichen Grundausstattung. Dies dachte und denke ich nicht beim Lesen von Täteraussagen, welche die Abwesenheit von M. deutlich begründen („Es waren keine Menschen für uns“), immer wieder erinnere ich die Aussage einer Schülerin, 16jährig, mehr sei nicht über sie gesagt. Nach einem mühsamen Gespräch über M. mit der Klasse, an der sich die meisten durch Äuszerungen akuter Langeweile einbringen, spricht sie:
„Ich hab kein Mitleid mit anderen Leuten.“
Ich bin sicher, dasz sie mit den Tätern das teilt, was der Filmemacher Eberhard Fechner den Angeklagten des Maidanek-Prozesses attestierte, nämlich einen aufreizenden Mangel an Phantasie.
„Ich hab kein Mitleid mit anderen Leuten.“ Ich stelle mir ein dekoratives Durcheinander, eine farbenfrohe Lawine vor, die alle Etikettierungen, alle Begriffe und alle Subjekte durcheinandergeschüttelt hat. Dann einiges zusammenrechen, anderes liegen lassen. Bestimmt ist Wehklagen zu vernehmen. Alles bleibt überschaubar und ist nicht zu vergleichen mit dem Phänomen des Umsturzes nach der Befreiung 1945, die ich hier gern mal Stunde null nennen möchte: eine absurde Verkehrung aller Befindlichkeiten. Der Scham und der Schuld der Überlebenden steht ein solides Selbstmitleid der Täter gegenüber.
IV. „Was geht das mich an“
(Eine Broschüre, 1976, Hg. Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück)
Zeit, das Mitgefühl zu erfinden. Etwas Drittes lebt zwischen Mitleid und Empathie, zwischen falscher Nähe und professioneller Distanz. („Professionell“ dies Un-Wort, an jedem Messer-Set pappt es, Heilsbringerei zwischen Konventionalität und garantierter Nicht-Einmischung.)
Mitgefühl ist ein Pfeil. Oder eine Zeigerpflanze. Oder der Anfang von allem.
Der Pfeil von mir zu Dir, die Zeigerpflanze für Kulturen der Mitmenschlichkeit, der Kern aller Moralität, vielleicht jedenfalls. Ich komme noch mal darauf zurück.
Mitgefühl habe ich mit der eben zitierten jungen Frau aus der Broschüre. 10 Prozent Mitgefühl, 20 Prozent Überheblichkeit, 30 Prozent Ekel, 30 Prozent Amüsiertheit, 10 Prozent Neugierde. Mit den 20 Prozent Mitgefühl und Neugierde formuliere ich: Was ist da passiert? Was für ein Gefühl hat das Mädchen sich selbst gegenüber? Wenn es nur für Selbstmitleid reicht, ist die Ausstattung dürftig.
Voll krass ey, ausgerechnet die, also nicht der, hat da kein Mitgefühl mit Anderen. Wo Mädchen doch gefühlvoller sind, ist doch bekannt. Irgendwie besonders schlimm. Als Figur oder als Folie der Entrüstung, als pädagogischer Avatar begegnete sie mir in einer fast 30 Jahre alten Broschüre, herausgegeben von der Österreichischen Lagermeinschaft Ravensbrück, das ist der Verband der Überlebenden des Konzentrationslagers Ravensbrück.
Ein Schmollmündchen, ein hohes Näschen, geschminkte Katzenaugen, daneben der Satz „Was geht das mich an“. Kein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen.
Eine Schwester im Geiste, von der Generation her kann es fast die Groszmutter sein, na, in diesen bildungsfernen Schichten werden ja früh Kinder gemacht, also die ahnungslose Ahnin des Mädels von der Exkursion in die Gedenkstätte? Erst auf den zweiten und dritten Blick, die Inszenierung unter der Titelzeile „Ravensbrück“ schlug mich ausreichend in den Bann, erkenne ich das blasse Hintergrundphoto. Hinter dem Schmoll-Teenager ein Photo, eine Quelle ist nicht angegeben, es sind nackte abgemagerte menschliche Gliedmaszen mit klumpigen Gelenken, teilweise mit gestreiften Stoff-Fetzen zu sehen, vereinzelt Schädel, mit und ohne Gesichtshaut, Augenhöhlen. Die Körper bilden einen Haufen. Im Inneren des Heftes drei Abbildungen des jungen Mädchens, das erste verstört-empört, das dritte zeigt das Mädchen mit aufgerissenen Augen, geöffneten Lippen und zwei zum Gesicht erhobenen Händen, eine davon zur Faust geballt. Mit dem mittleren Photo bekommt das Mädchen einen Namen, trägt ein sympathisches Lächeln, die dunklen Haare wie für ein freundliches Paszbild aus dem Gesicht gekämmt. „Claudia 1963“ Darüber ein Photo von „Anni 1938“.
Kein Zweifel: „Claudia“ soll als normale Jugendliche andere normale Jugendliche an die Verbrechen der Nazis heranführen und in ihnen Furcht, Schrecken und Anteilnahme erwecken.
Ich blättere in der Broschüre, die übrigens mit weit überhöhten Opferzahlen beginnt und freue mich über die Fortschritte, die seither auf dem Gebiet der Pädagogisierung des Völkermords gemacht worden sind.
Ein bewuszter Anklang? Das aktuelle Vermittlungskonzept an der Gedenkstätte Mauthausen, erstellt 2011, heiszt „Was hat es mit mir zu tun?“
Das mit Anni und Claudia war schon ganz richtig, richtig in dem Sinne, dasz es leichter ist, sich mit Personen ähnlichen Alters und ähnlichen Lebenssituationen zu identifizieren und richtig in dem Sinne, dasz „Anni“ Teil aktueller pädagogischer Konzepte ist.
Und dann sind da noch die Photos. Der Hintergrund. Der Abgrund. Photos, die jede Würde verletzen, Photos von Nicht-Menschen, alle Tabus verletzend, Photos, die allierte Truppen bei der Befreiung der Lager als Beweismittel machten. Photos, die ein Objektiv schieben zwischen dem gröszten anzunehmenden Unheil und den Soldaten der vorrückenden Armeen, die in keiner Weise vorbereitet waren auf das, was sie rochen, hörten, sahen.
Rätselhaft ist mir die Erwartung, mit Darstellungen von Unmenschlichkeiten Mitmenschlichkeit im Sinne von Mitgefühl zu erregen. Was hat das mit mir zu tun.
V. Im Spiegelkabinett
Zeit, ein Labor aufzusuchen. Die Nervenfasern herauspräparieren, die Synapsen verkabeln, Genstränge nummerieren oder isolieren, Hirnareale kartieren, Leitungen prüfen, Emotionen oder Haltungen, etwas von dem musz Empathie sein, messen, wiegen, zählen. Vom Besonderen des Einzelnen zur Allgemeinheit der Menschenrasse kommen und die erste Assoziation „Menschheit, mitleidlos“ passieren lassen. Fragen, unter Laborbedingungen, weiszes Wissen, Weisz-abgleich zum dreckigen Drauszen, Fragen, ob die Empathie-Fähigkeit zur menschlichen Grundausstattung gehört.
Die Laboranten, die sich Exemplare der menschl. Spezies vornehmen, fraglich, ob sie sich selbst dabei fragen, in welchem Verhältnis sie zum Untersuchungs-gegenstand stehen, nehmen sich in verschiedenen Jahrzehnten verschiedene Körper- oder Geistabschnitte des Menschen vor.
Ein Beispiel aus dem Jahre 2008: Neurologen von der Universität Iowa und aus Harvard konfrontierten Testpersonen mit einem moralischen Dilemma: ist es legitim einen Menschen zu töten, um damit viele andere zu retten? Es war ihnen zu tun um die Herkunft der Urteilskraft – stammt sie eher aus dem für Emotionen zuständigen limbischen Bereich oder dem präfrontalen Kortex, der mit kognitiven Leistungen in Verbindung gebracht wird. HirnScans zeigten Aktivitäten in beiden Regionen. Was zu erwarten war. Um zu beweisen, wer das Sagen hat im Oberstübchen, testeten sie Personen mit einem defekten VMPC (ventromedialer präfrontaler Cortex), das ist der Mittler zwischen den beiden Regionen, die mit Emotion vs. Ratio gelabelt werden.Die Versuchspersonen, deren Gefühlswelten unverkabelt neben ihrem Sachverstand bestanden, zögerten nicht, Menschenleben zu opfern.
In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gingen US-amerikanische Psychologen in Menschen-Versuchen sehr viel weiter, im sog. Milgram- und im Stanford-Experiment (Stanley Milgram u.A., Univ. Yale, 1961; Univ. Stanford, 1971, Philip Zimbardo) setzten sie Menschen in Versuchsanordnungen, um ihren Autoritätsgehorsam und ihr Verhalten unter Konformitätsdruck zu testen.
Die Versuche wären heute nicht mehr zulässig.
Zumindest nicht in den Vereinigten Staaten. In beiden Versuchen gingen Menschen an ihre eigenen Grenzen und über die Grenzen von anderen Menschen hinweg – im bekannteren Milgram-Experiment aus den 60ern für die Wissenschaft. Probanden erteilten anderen Probanden, die in Wirklichkeit Schauspieler waren, Stromstösze (auch die waren nicht real), wenn die Versuchspersonen nicht richtig funktionierten. Aufgabe der Versuchsleiter, Schauspieler auch sie, war es, die Probanden bei Zweifeln, also bei Regungen von Gewissen und Empathie, zum Weitermachen zu bewegen. 26 Personen gingen bis zum Ende und bis zu tödlichen Stromstöszen, 14 Personen brachen das Experiment ab. Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Probanden waren statistisch nicht relevant.
Das Setting des Stanford-Experiments hetzt Männer in der Rolle von Wärtern und Männer in der Rolle von Häftlingen aufeinander. Nach drei Tagen muszte das Experiment abgebrochen werden, es war auszer Kontrolle geraten, einige „Häftlinge“ waren bedroht. Es trifft nicht zu, dasz sich alle „Wärter“ sadistisch verhalten haben – es war nur ein Drittel.
Die Bedingungen für handlungsleitendes Mitleid waren wiederum extrem reduziert,
in dem einen Versuch durch die Autorität der Wissenschaft und den Auftritt der Wissenschaftler. Im anderen Experiment durch die standardisierte De-Humanisierung der „Häftlinge“. Sie hatten keine Namen, sie hatten Nummern. Sie waren dreckig. Sie waren zusammengepfercht.
Im Spiegelirrgarten auf dem Rummelplatz. Verschieden gesteckt sind die Spiegelwände, ergeben kleine Boxen, Auswege müssen ertastet werden, in einigen Boxen sitzen Puppen, Monster, Figuren, die sich seltsam bewegen. Ist man nach Minuten und gefühlten Stunden der Inszenierung entkommen, überlegt man, ob es die Beklemmung des geschlossenen Raumes, die Absurdität der abgewetzten Puppen oder die ständige Begegnung mit dem Spiegelbild ist, die die Herausforderung darstellt. Die Angst-Lust, für die man bezahlt hat. Menschen ganz dicht zu begegnen, mein Gesicht und Dein Gesicht trennt nur eine Handlänge, sofort reagieren, ausweichen und sofort lächeln, die Situation entschärfen, das Gegenüber lächelt zurück, spiegelt meine Reaktion. Variabel nach Geschlecht und nach Kultur. Bewuszt das eigene Spiegelbild anlächeln, im Fahrstuhl, im Kaufhaus, an anderen Orten von Dichtestresz schafft Vertrautheit.
Diese Spiegelung, diese Gefühlsansteckung gehört zum ersten, was das Neugeborene lernt, besser: lernen kann, wenn es von Eltern oder Anderen versorgt wird, die es Anlachen und anderen Schabernack mit ihm treiben. Kinder erwidern derlei schon nach wenigen Monaten, mit vier Jahren ist die Entwicklung der Neuronen, die dafür verantwortlich gemacht werden, im Wesentlichen abgeschlossen.
Fast so spektakulär wie die Celebrierung der DNA-(Er)findung, so plausibel wie die Instalierung des Genoms als Alleserklärer scheint die Entdeckung der Spiegelneuronen in den 1990er Jahren.
Als Durchbruch gilt das Jahr 1992 oder das Jahr 1996, Ort der Handlung sind die Labore der Universität Parma, Italien. Der Neurologe Giacomo Rizzolatti hatte bei Versuchen mit Makaken und Schimpansen festgestellt, dasz ein beobachtender Affe die gleichen Hirnreflexe aufweist wie ein wirklich nach einer hingelegten Nusz greifender. Doch der Anfang der Erkenntnis soll ein anderer und ganz zufälliger gewesen sein: einer der Forscher habe nach einer Nusz gegriffen und somit das ausgeführt, was zunächst die Versuchs-Affen taten, während bei ihnen die Hirn-Aktivitätsmuster gemessen wurden. Zur Überraschung Rizzolattis habe nun der beobachtende Affe mit den Elektroden am Kopf den unverkabelten Menschen mit der Nusz gesehn und in seinem Hirn, genauer gesagt in Nervenzellen im präfrontalen Cortex spiegelte sich das Nusz-Greif-Verhalten. 2010 habe eine Studie den Nachweis des gleichen Mechanismus beim Menschen erbracht. Nicht nur körperliche, auch seelische Erregungsmuster spiegelten sich von Hirn zu Hirn, von Primat zu Primat.
Schon da wurden die Nervenzellen beklatscht und umjubelt: sie seien der Schlüssel für Ich-Entgrenzung, für Kulturfähigkeit, für Empathie.
Im Marketing, Absatzwirtschaft in deutsch oder in Wirklichkeit die Wissenschaft von der Erhöhung des Umsatzes, interessiert man sich stark für die Empathie, erhöhe die E.-Kompetenz doch die Vertriebs-Kompetenz. Auch für Führungs-Kompetenz sei sie unerläszlich. Daraus folgt die Erfindung von Seminaren und Workshops zum Erlernen dieser „skill“ für „Entscheider“. Schwundformen des Mitgefühls für Schundkonsum-Ankurbelung (so die Stimmen aus Prekariat und Neidgesellschaft).
Das Nasenspray-Experiment, doppelblind
Zusammenfassend wandten sich weiszbekittelte Männer und Frauen dem Verhalten unter Laborbedingungen und den Neuronen im vorderen Hirn zu auf der Suche nach den Erstaunlichkeiten Mitleid und Empathie. Erstaunen versetzt Erstaunen. Ein kleines Erstaunen gilt dem noch nicht gesuchten Mitleid-Gen. (Zu suchen und zu finden allein in den Mitleid’gen.) Das Staunen steigert ein Blick in die medizinische Forschung der Universität Bonn, wo im Rahmen einer randomisierten Doppelblindstudie nach einer Oxytitocingabe via Nasenspray die kognitive und die emotionale Empathie getestet wurde. Das Setting bedeutet, dasz weder die teilnehmenden Probanden noch die veranstaltenden Mediziner wissen, welche Probandengruppe das sog. Verum und welche das Placebo erhält. Die Probanden-Gruppen werden zufällig bestimmt.
Die Substanz Oxytocin ist ein Neuropeptid, d.h. ein Botenstoff im Nervengewebe, produziert im Hypophysen-Hinterlappen und bislang vor allem bekannt dafür, Kontraktionen der Gebärmutter und die Milchproduktion auszulösen. Es bestand der Verdacht, dasz die intranasale Gabe von Oxytocin, die Boulevard-Presse nennt es gern „Kuschel-Hormon“, die Empathiefähigkeit steigert. Die Studie von Tobias Baumgartner, die zunächst eine unzureichende Datenlage konstatiert, kam 2012 zu dem Ergebnis, dasz sich die Veränderung der kognitiven Empathie („Wie fühlt sich diese Person?“) nicht signifikant erhöht, die emotionale Empathie („Wie sehr fühlen Sie mit dieser Person?“, „Wie sehr erregt Sie dieses Bild?“) aber ja.
Wegen der Wirkung auf weibliche Organe wurden nur Männer getestet.
Aufgrund der Neuheit der Ergebnisse und eines sehr engen Mitleids-Feldes, ähnlich einer langgestreckten kurzrasigen Parzelle, scheint die Einrichtung von entsprechenden Nasenspray-Ausgabestationen an Ausfallstraszen und vor Clubs, vor denen Männer oft ausfällig werden, nicht vordringlich.
Inzwischen hören wir das Nörgeln der Skeptiker und Spiegelfechter. Nicht, dasz sie einen anderen Stein der Weisen gefunden hätten, vielleicht misztrauen sie nur generell dieser Erkenntnis-Alchemie, dieser Weltformel-Goldschürferei.
VI. Vorhang zu, die Wörter treten vor
Ein Bus hat uns in die gepflegte Vorstadt des Mitleids transportiert, die Literatur in die Verwüstungen des Krieges und Lessings groszen Einspruch gegen die Barbarei oder den Lauf der Zeit, wir spazierten über eine Gedenkstätte vieltausendfachen Mordes und besahen pädagogische Kniffe, um mit der Fähre über zu setzen wir zur gekachelten Insel der Wissenschaft.
Und halten nun inne, in der Hand, wie ein Ticket, die gefundenen Wörter. Empathie, Mitleid, Mitgefühl.
Der Reiserei in die Empathie-Landschaften liegt ein Übersetzungs-Fehler zugrunde; die Autorin bittet um Vergebung, da es sich um einen bewuszten Fehler handelt. Sie hat Mitleid mit Empathie übersetzt. Mit-Leid ist aber wörtlich die Sym-Pathie. Die Empathie ist jung, der dt. Philosphieprofessor Rudolf Hermann Lotze (1817 – 1881) schrieb sie 1848 auf einen Zettel. Durch den britisch-amerikanischen Experimentalpsychologen Edward Bradford Titchener (1867 – 1927) kursierte er, diente der Einhandlung von etwas Altem. Oder Neuem?
Auf der Suche nach den Ursachen der Moral machte David Hume im 18. Jahrhundert das Gefühl aus,
ein Gefühl in uns, ein Gefühl mit Mitmenschen. In seiner Untersuchung über die Prinzipien der Moral, erschienen 1751, mithin fast im selben Jahr des Diktums von Mendelssohn und Lessing „Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch“, befragt Hume die menschliche Gesellschaft folgendermaszen:
„Haben wir irgendwelche Schwierigkeit, die Macht von Menschlichkeit und Wohlwollen zu begreifen?
Oder zu verstehen, daß der bloße Anblick von Glück, Freude und Wohlstand Vergnügen bereitet?
Und der von Schmerz, Leiden und Sorge Unbehagen verursacht?
Das Antlitz des Menschen, sagt Horaz, leiht sich das Lächeln und die Tränen vom Antlitz des Menschen. Man versetze ein menschliches Wesen in die Einsamkeit, und es verliert jede Freude, außer der sinnlichen und spekulativen; und dies ist deshalb so, weil die Regungen seines Herzens nicht durch entsprechende Regungen bei seinen Mitmenschen gefördert werden. (…) die natürlichen Symptome, Tränen, Schmerzenslaute und Stöhnen verfehlen nie, uns mit Mitleid und Unbehagen zu erfüllen.“
(David Hume, Untersuchung über die Prinzipien der Moral, herausgegeben und übersetzt von Gerhard Streminger, Stuttgart 1984, S. 142)
Das Mitleid, das uns erfüllt beim Unglücke Anderer ist die Compassion. Über ihr aber steht bei Hume und auch den anderen „groszen Schotten“ die SYMPATHIE, das Wohlwollen allen Lebenden gegenüber, das ist die Gesellschaft stiftende Fähigkeit, die dem Egoismus entgegenstehende Tugend.
Hume war 18 Jahre älter als Lessing. Beide verbindet, dasz sie niemals eine Professur oder eine königliche Kanzleistelle oder irgendeine feine Pfründe genieszen durften, dasz sie aus engen protestantischen Milieus stammten – und beide setzten sich in erst posthum veröffentlichen Schriften mit ihrer Religion auseinander. Humes Schriften schafften es auf den päpstlichen Index, Lessing hatte nach dem sog. Fragmentenstreit Publikationsverbot. Lessings Fragment „Über die Entstehung der geoffenbarten Religion“ könnte von Hume inspiriert sein. Humes „Dialogues concerning Natural Religion“, entstanden in der Mitte des 18. Jahrhunderts, erschienen erst 1879.
Das Radikale: es ist für das Gewissen des Menschen kein Gott vonnöten, auch keine Spiegelneuronen, keine Hormone, keine Gene.
Da es bis auf weiteres Asche zu sein scheint mit der Offenbarung, stofflich wie spirituell, sollten wir einstweilen beim alten Leib bleiben.
(Dezember 2014)